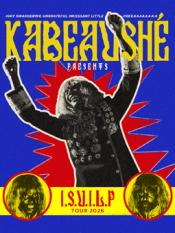D 2007, R: Johannes Schmid, mit: Johann Hillmann, Lea Eisleb, Konrad Baumann, 95 min, dt. OV
Martin, 12 Jahre alt, ist für sein Alter etwas zu klein, zu schmächtig und eher still, wie seine Mutter leider viel zu oft betont. Auf dem Kopf trägt er meistens eine Baseballkappe. Mit seinen Eltern ist er gerade in das verschlafene Bellbach gezogen. Neues Zuhause, neue Schule, aber noch keine neuen Freunde. Schon der erste Tag in Bellbach bringt Ärger. Beim Einkauf verpfeift Martin ungewollt einen Jungen, der Zigaretten klaut, und Oliver schwört der "Blöden Mütze" natürlich Rache! Der zweite Tag läuft nicht viel besser: Martin kommt ausgerechnet in Olivers Klasse. Der behandelt Martin sehr schlecht und will nichts mit ihm zu tun haben. Zu allem Überfluss ist er auch noch ein enger Freund der bezaubernden Silke. Und die würde Martin doch so wahnsinnig gerne besser kennen lernen! Es stellt sich heraus, dass Oliver sich so rebellisch und launisch verhält, weil er mit seinen Eltern große Probleme hat.
Wird Martin es schaffen, Silke und Oliver als neue, echte Freunde gewinnen zu können? Werden Martin und Silke Oliver bei seinen Problemen helfen können? Martin wird dafür sehr mutig sein müssen. Er wird versuchen müssen, seine Ängste, die ihn quälen, zu überwinden. Nicht nur um Oliver zu helfen. Sondern auch, um seine neuen Gefühle zu akzeptieren und Silke gegenüber ehrlich zuzugeben.
Für alle ab 10 Jahre.
E I N T R I T T: 2 Euro
11
// Mi // 20 Uhr //
LESBIAN SPACE PRINCESS (dt. Synchronfassung)
AUS 2025, R: Leela Varghese & Emma Hough Hobbs, 86 min.
Die introvertierte Prinzessin Saira, Tochter der lesbischen Königinnen des Planeten Clitopolis, ist am Boden zerstört: Die heiße Kopfgeldjägerin Kiki hat mit ihr Schluss gemacht – aus lauter Langeweile! Dabei hat Saira ihr ein so schönes Beziehungsalbum gebastelt! Doch als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, den Incels der Zukunft, muss Saira den Safe Space des queeren Weltraums verlassen und sie binnen 24 Stunden freikaufen: Die Maliens fordern nämlich die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unglaublicher lesbischer Macht. Das einzige Problem… Saira hat sie nicht!
Umwerfend witzig, knallbunt, euphorisch, kompromisslos queer: Der erste Langfilm des australischen Regie-Duos Leela Varghese und Emma Hough Hobbs ist ein mitreißender intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall, irgendwo zwischen wilder Sci-Fi-Musical-Komödie und heilsamer Coming-of-Age-Abenteuerreise.
Der Film überzeugt nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Synchronfassung mit Lena Urzendowsky („In die Sonne schauen“), Jasmin Tabatabai („Bandits“, „Fremde Haut“), Katy Karrenbauer („Satanische Sau“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“), Genet Zegay („Jugend ohne Gott“), Lana Cooper („Love Steaks“, „Looping“) und Kelly Heelton („Drag Race Germany“).
am Mittwoch, 11.02. und Freitag, 13.02.: dt. Synchronfassung
am Donnerstag, 12.02.: engl. OV mit dt.UT
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild)
Die introvertierte Prinzessin Saira, Tochter der lesbischen Königinnen des Planeten Clitopolis, ist am Boden zerstört: Die heiße Kopfgeldjägerin Kiki hat mit ihr Schluss gemacht – aus lauter Langeweile! Dabei hat Saira ihr ein so schönes Beziehungsalbum gebastelt! Doch als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, den Incels der Zukunft, muss Saira den Safe Space des queeren Weltraums verlassen und sie binnen 24 Stunden freikaufen: Die Maliens fordern nämlich die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unglaublicher lesbischer Macht. Das einzige Problem… Saira hat sie nicht!
Umwerfend witzig, knallbunt, euphorisch, kompromisslos queer: Der erste Langfilm des australischen Regie-Duos Leela Varghese und Emma Hough Hobbs ist ein mitreißender intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall, irgendwo zwischen wilder Sci-Fi-Musical-Komödie und heilsamer Coming-of-Age-Abenteuerreise.
Der Film überzeugt nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Synchronfassung mit Lena Urzendowsky („In die Sonne schauen“), Jasmin Tabatabai („Bandits“, „Fremde Haut“), Katy Karrenbauer („Satanische Sau“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“), Genet Zegay („Jugend ohne Gott“), Lana Cooper („Love Steaks“, „Looping“) und Kelly Heelton („Drag Race Germany“).
am Mittwoch, 11.02. und Freitag, 13.02.: dt. Synchronfassung
am Donnerstag, 12.02.: engl. OV mit dt.UT
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild)
12
// Do // 20 Uhr //
LESBIAN SPACE PRINCESS (engl. Originalfassung mit dt. UT)
AUS 2025, R: Leela Varghese & Emma Hough Hobbs, 86 min.
Die introvertierte Prinzessin Saira, Tochter der lesbischen Königinnen des Planeten Clitopolis, ist am Boden zerstört: Die heiße Kopfgeldjägerin Kiki hat mit ihr Schluss gemacht – aus lauter Langeweile! Dabei hat Saira ihr ein so schönes Beziehungsalbum gebastelt! Doch als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, den Incels der Zukunft, muss Saira den Safe Space des queeren Weltraums verlassen und sie binnen 24 Stunden freikaufen: Die Maliens fordern nämlich die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unglaublicher lesbischer Macht. Das einzige Problem… Saira hat sie nicht!
Umwerfend witzig, knallbunt, euphorisch, kompromisslos queer: Der erste Langfilm des australischen Regie-Duos Leela Varghese und Emma Hough Hobbs ist ein mitreißender intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall, irgendwo zwischen wilder Sci-Fi-Musical-Komödie und heilsamer Coming-of-Age-Abenteuerreise.
Der Film überzeugt nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Synchronfassung mit Lena Urzendowsky („In die Sonne schauen“), Jasmin Tabatabai („Bandits“, „Fremde Haut“), Katy Karrenbauer („Satanische Sau“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“), Genet Zegay („Jugend ohne Gott“), Lana Cooper („Love Steaks“, „Looping“) und Kelly Heelton („Drag Race Germany“).
am Mittwoch, 11.02. und Freitag, 13.02.: dt. Synchronfassung
am Donnerstag, 12.02.: engl. OV mit dt.UT
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild).
Die introvertierte Prinzessin Saira, Tochter der lesbischen Königinnen des Planeten Clitopolis, ist am Boden zerstört: Die heiße Kopfgeldjägerin Kiki hat mit ihr Schluss gemacht – aus lauter Langeweile! Dabei hat Saira ihr ein so schönes Beziehungsalbum gebastelt! Doch als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, den Incels der Zukunft, muss Saira den Safe Space des queeren Weltraums verlassen und sie binnen 24 Stunden freikaufen: Die Maliens fordern nämlich die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unglaublicher lesbischer Macht. Das einzige Problem… Saira hat sie nicht!
Umwerfend witzig, knallbunt, euphorisch, kompromisslos queer: Der erste Langfilm des australischen Regie-Duos Leela Varghese und Emma Hough Hobbs ist ein mitreißender intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall, irgendwo zwischen wilder Sci-Fi-Musical-Komödie und heilsamer Coming-of-Age-Abenteuerreise.
Der Film überzeugt nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Synchronfassung mit Lena Urzendowsky („In die Sonne schauen“), Jasmin Tabatabai („Bandits“, „Fremde Haut“), Katy Karrenbauer („Satanische Sau“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“), Genet Zegay („Jugend ohne Gott“), Lana Cooper („Love Steaks“, „Looping“) und Kelly Heelton („Drag Race Germany“).
am Mittwoch, 11.02. und Freitag, 13.02.: dt. Synchronfassung
am Donnerstag, 12.02.: engl. OV mit dt.UT
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild).
13
// Fr // 20 Uhr //
LESBIAN SPACE PRINCESS (dt. Synchronfassung)
AUS 2025, R: Leela Varghese & Emma Hough Hobbs, 86 min.
Die introvertierte Prinzessin Saira, Tochter der lesbischen Königinnen des Planeten Clitopolis, ist am Boden zerstört: Die heiße Kopfgeldjägerin Kiki hat mit ihr Schluss gemacht – aus lauter Langeweile! Dabei hat Saira ihr ein so schönes Beziehungsalbum gebastelt! Doch als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, den Incels der Zukunft, muss Saira den Safe Space des queeren Weltraums verlassen und sie binnen 24 Stunden freikaufen: Die Maliens fordern nämlich die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unglaublicher lesbischer Macht. Das einzige Problem… Saira hat sie nicht!
Umwerfend witzig, knallbunt, euphorisch, kompromisslos queer: Der erste Langfilm des australischen Regie-Duos Leela Varghese und Emma Hough Hobbs ist ein mitreißender intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall, irgendwo zwischen wilder Sci-Fi-Musical-Komödie und heilsamer Coming-of-Age-Abenteuerreise.
Der Film überzeugt nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Synchronfassung mit Lena Urzendowsky („In die Sonne schauen“), Jasmin Tabatabai („Bandits“, „Fremde Haut“), Katy Karrenbauer („Satanische Sau“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“), Genet Zegay („Jugend ohne Gott“), Lana Cooper („Love Steaks“, „Looping“) und Kelly Heelton („Drag Race Germany“).
am Mittwoch, 11.02. und Freitag, 13.02.: dt. Synchronfassung
am Donnerstag, 12.02.: engl. OV mit dt.UT
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild)
Die introvertierte Prinzessin Saira, Tochter der lesbischen Königinnen des Planeten Clitopolis, ist am Boden zerstört: Die heiße Kopfgeldjägerin Kiki hat mit ihr Schluss gemacht – aus lauter Langeweile! Dabei hat Saira ihr ein so schönes Beziehungsalbum gebastelt! Doch als Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, den Incels der Zukunft, muss Saira den Safe Space des queeren Weltraums verlassen und sie binnen 24 Stunden freikaufen: Die Maliens fordern nämlich die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unglaublicher lesbischer Macht. Das einzige Problem… Saira hat sie nicht!
Umwerfend witzig, knallbunt, euphorisch, kompromisslos queer: Der erste Langfilm des australischen Regie-Duos Leela Varghese und Emma Hough Hobbs ist ein mitreißender intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall, irgendwo zwischen wilder Sci-Fi-Musical-Komödie und heilsamer Coming-of-Age-Abenteuerreise.
Der Film überzeugt nicht nur im Original, sondern auch in der deutschen Synchronfassung mit Lena Urzendowsky („In die Sonne schauen“), Jasmin Tabatabai („Bandits“, „Fremde Haut“), Katy Karrenbauer („Satanische Sau“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“), Genet Zegay („Jugend ohne Gott“), Lana Cooper („Love Steaks“, „Looping“) und Kelly Heelton („Drag Race Germany“).
am Mittwoch, 11.02. und Freitag, 13.02.: dt. Synchronfassung
am Donnerstag, 12.02.: engl. OV mit dt.UT
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild)
19
// Do // 20 Uhr // SHORTS ATTACK (10 Filme in 80 Minuten - alle in OmU)
GOLDEN SHORTS: SciFi-KLASSIKER
Eine wilde Mischung erlesener Science Fiction-Filme der letzten Jahre: Mal geht am Raumschiff was kaputt, mal eskaliert der Haushaltsroboter. Aliens trotzen dem irdischen Schönheitsideal oder rechnen nicht mit dem Menschen. Apokalypsen kommen mal opulent, mal durch Manipulation. Es gibt Smartphones für Tiere, Stau am gigantischen Tunnel, und einen Mond, der den Menschen nicht mag. Das aber sollte klappen: Trampen ins All!
Mit dabei u.a.
PARADISIAC
F 2001, R: Igor Pejic, 4 min
Alien im Kornfeld
Ein Außerirdischer stürzt auf die Erde. Er ist fasziniert von der Natur, die ihn umgibt. Die nächste Begegnung wird mit dem Mensch sein!
ON / OFF
F 2013, R: Thierry Lorenzi, 14 min
Astronautin auf Identitätssuche
Die Astronautin Meredith kommuniziert mit der Erde und stößt bei Reparaturarbeiten am Raumschiff auf essentielle Hintergründe ihrer Identität.
ALPHA CENTAURI
D 2011, R: Michael Seidel, 2 min
Trampen ins All
Bei seinen Reisezielen ist dieser Tramper nicht allzu wählerisch: Er wählt wahlweise Auto oder Raumschiff. Doch nicht alle halten.
THE TUNNEL
Nor 2016, R: André Øvredal, 15 min
Mobilitäts-Thriller
In einer überbevölkerten Zukunft ist eine Familie auf dem Heimweg. Zwischen ihnen und ihrer gigantischen Heimatstadt wartet ein riesiger Tunnel.
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild).
Mit dabei u.a.
PARADISIAC
F 2001, R: Igor Pejic, 4 min
Alien im Kornfeld
Ein Außerirdischer stürzt auf die Erde. Er ist fasziniert von der Natur, die ihn umgibt. Die nächste Begegnung wird mit dem Mensch sein!
ON / OFF
F 2013, R: Thierry Lorenzi, 14 min
Astronautin auf Identitätssuche
Die Astronautin Meredith kommuniziert mit der Erde und stößt bei Reparaturarbeiten am Raumschiff auf essentielle Hintergründe ihrer Identität.
ALPHA CENTAURI
D 2011, R: Michael Seidel, 2 min
Trampen ins All
Bei seinen Reisezielen ist dieser Tramper nicht allzu wählerisch: Er wählt wahlweise Auto oder Raumschiff. Doch nicht alle halten.
THE TUNNEL
Nor 2016, R: André Øvredal, 15 min
Mobilitäts-Thriller
In einer überbevölkerten Zukunft ist eine Familie auf dem Heimweg. Zwischen ihnen und ihrer gigantischen Heimatstadt wartet ein riesiger Tunnel.
T I C K E T S gibt es online bei tixforgigs (Link unterm Bild).